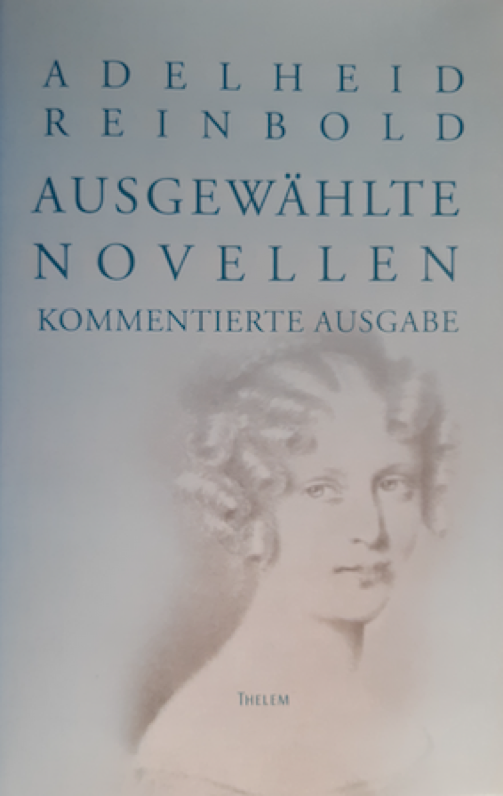
Inzwischen – 2025 – ist eine sehr schöne Ausgabe erschienen: Adelheid Reinbold. Ausgewählte Novellen [Das Wunder. Die Nebenbuhlerin ihrer selbst. Russische Szenen]. Herausgegeben von Kerstin Marasch und Matthias Dähn. Mit einem Nachwort von Jakob Christoph Heller. Thelem, Dresden und München, 2025
Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Hannover:
“Bedeutende Frauen Hannovers“ anlässlich der 750 Jahrfeier der Stadt Hannover
Vortrag am 14. März 1991
“Ein wahres Talent, das zu schönen Hoffnungen berechtigt. Die Romantikerin Adelheid Reinbold (1800 -1839)
Hilde Fieguth, ausgewählte Texte liest Lilli Hoffmann
Ich nehme an, dass kaum jemand von Ihnen die “bedeutende Frau Hannovers“ Adelheid Reinbold kennt, geschweige denn, etwas von ihren Werken gelesen hat. Deshalb sollte ich wohl erzählen, wie ich die Bekanntschaft dieser Schriftstellerin gemacht habe. Auf Umwegen, zufällig. Eigentlich war ich auf der Suche nach Gartenschilderungen in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, die ich dann in Bilder umsetzen wollte (eigentlich bin ich Malerin), daraus entstand dann eine Anthologie mit solchen Schilderungen, die es in fast jedem literarischen Werk dieser Zeit gibt. Beim Suchen nach solchen Texten, also beim Lesen unendlich vieler Werke, stieß ich auf Sophie Tieck, die Schwester des berühmten Ludwig Tieck und wollte auf Anregung von Luise Pusch, die damals gerade den Band “Schwestern berühmter Männer“ herausgab, mehr über sie erfahren. Sophie Tieck war auch literarisch tätig gewesen. Nun nähern wir uns allmählich Adelheid. Über die Schwester Sophie gab es kaum Literatur, wohl aber über Ludwig. Kurz vor seinem Tod hatte der alte gichtkranke Dichter vom Bett aus dem Schriftsteller Rudolf Köpke seine lange erwarteten Erinnerungen diktiert. Und in diesen gedenkt Ludwig ausführlich einer längst verstorbenen Freundin, Schülerin und Verehrerin, und jetzt endlich steht Adelheid Reinbold vor uns. Hören wir uns an, mit welchen Worten Tieck sie in seinen Erinnerungen schildern lässt:
“Schon vor 1830 hatte Tieck’s geselliger und freundschaftlicher Kreis ein neues Mitglied in der Verfasserin der Novellen gewonnen, welche später unter dem Namen Franz Berthold erschienen. Unter den zahlreichen deutschen Schriftstellerinnen ist Adelheid Reinbold eine der begabtesten, und doch ist kaum eine weniger anerkannt worden. Was sie besaß und vermochte, selbst ihre Dichtungen, hatte sie dem Leben in hartem Kampfe abgerungen. Schon als junges Mädchen war sie auf sich selbst, auf ihre eigene Kraft angewiesen. Sie stammte aus einer hannoverischen Beamtenfamilie, in der, wie nicht selten in den mittlern Ständen, Bildung, Anlage und Lebensansprüche nicht durch genügende Mittel unterstützt werden konnten. Früh machte sie manches verborgene Leiden durch. Dennoch erwarb sie reiche Kenntnisse in Sprachen und Wissenschaft, und suchte sich dadurch eine selbständige Stellung zu schaffen. (…)
Sie war eine glänzende Erscheinung, schön, lebhaft, geistreich, von seltener Schnellkraft und Thätigkeit, und im vollsten Besitze der modernen geselligen Bildung. Berufen für das Leben in der großen Welt, war sie an die engsten und beschränktesten Verhältnisse gebunden. Sie war fern von jeder Weichheit und Sentimentalität, und besaß eine männliche Kraft des Talentes. Zu weiterer Fortbildung, zu eigenen Schöpfungen fühlte sie sich hingedrängt, sie wollte aussprechen, was sie in sich und unter schweren Verhältnissen erlebt hatte. (…) Seit 1834 lebte sie in Dresden… Mit voller Selbstverleugnung und Aufopferung verwandte sie ihr Talent, um die Ihren zu unterstützen; sie selbst beschränkte sich auf das Nothwendigste. In der Familie eines einfachen Handwerkers hatte sie sich eingemiethet, deren kleines häusliches Leben sie theilte. Auf ihrem Zimmer schrieb sie Dramen, Novellen und Kritiken, und in der Gesellschaft erschien sie als Weltdame. Jetzt ward sie in Tieck’s Familie heimisch. Ihm selbst fast leidenschaftlich ergeben, war sie ein belebendes Element der Kreise, welche sich bei ihm versammelten. Sie beherrschte die Unterhaltung vollkommen, mochte ihr der Diplomat oder Philosoph, der Engländer, Franzose oder der deutsche Dichter gegenüberstehen. Stets erschien sie heiter, witzig, sprühend (…)“
Rufen wir uns in Erinnerung, dass Ludwig Tieck zu dieser Zeit in seiner Wohnung am Dresdner Altmarkt ein großes Haus hielt und immense Berühmtheit als Dichter und noch viel mehr als Vorleser und Deklamator genoss. Seine Leseabende waren so berühmt, dass er sogar in den Stadtführern von Dresden als “Sehenswürdigkeit“ geführt wurde und viele Bildungsreisende, vor allem Dichter, sich bei ihm einluden.
Sie können mir bestimmt nachempfinden, dass auf diese Schilderung von Tieck hin mein Interesse an dieser Frau und Schriftstellerin geweckt war. Ich wollte Genaueres über sie erfahren und fand sie tatsächlich in erstaunlich vielen Lexika verzeichnet, ausgehend natürlich von Elisabeth Friedrichs’ “Lexikon der deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts“ von 1981.
Adelheid Reinbold wurde 1800 in Hannover als Tochter der Friederike von Hoff und des königlich-kurfürstlichen Geheimen Kanzleisekretärs Karl Friedrich Reinbold geboren. Ihr Urgroßvater war als Oberkriegs-Zahlkommissar mit der späteren Kurfürstin Sophie aus der Pfalz gekommen (1658). Die Familie, obwohl angesehen, war verarmt und Vater und Mutter offenbar zu willensschwach, um an ihrer prekären Lage Wesentliches ändern zu können. Ihr Leben lang wird sich die älteste Tochter Adelheid (sie hat fünf Schwestern und sechs Brüder) für die Erziehung und das Fortkommen ihrer Geschwister verantwortlich fühlen. Mehrmals nimmt sie Stellungen als Erzieherin an, so beim reformorientierten Staatsmann August Wilhelm Rehberg in Hannover, eine Zeitlang in Wien im Haus des Bankiers Heinrich von Pereira, dessen Frau einen bekannten Salon führt, erträgt aber offenbar die Abhängigkeiten schlecht. Schließlich will sie ihren Lebensunterhalt mit ihrer Schriftstellerei und mit Kritiken für literarische Zeitschriften verdienen. Ludwig Tieck fördert sie dabei. Im Alter von 39 Jahren, zu dem Zeitpunkt, als sich ein gewisser Erfolg einzustellen scheint, stirbt sie plötzlich zum Entsetzen und Kummer ihrer Freunde an Diphterie.
Soweit der Lebenslauf. Jetzt gilt es, ihre Werke zur Kenntnis zu nehmen. Es handelt sich um einen zweibändigen Roman mit dem Titel “König Sebastian, oder wunderbare Rettung und Untergang“, um drei Bände mit Novellen, um verschiedene Dramenfragmente und eine Gedichtsammlung, sowie um eine größere Anzahl von Rezensionen, die über mehrere Jahre hin in den von Brockhaus herausgegebenen “Blättern für literarische Unterhaltung“ abgedruckt wurden. Diese Werke sind erschienen in den Jahren 1831 bis 1842, alle wurden von Ludwig Tieck herausgegeben, alle sind unter dem Pseudonym Franz Berthold erschienen. Erst in der Vorrede zu dem postum erschienenen Roman “König Sebastian“, die auch in Tiecks “Kritischen Schriften“ abgedruckt ist, lüftet er das Pseudonym.
Nach meinem Dafürhalten wird die schriftstellerische Qualität im Lauf der Jahre zunehmend besser. Sie selbst scheint von Zweifeln an ihrem Können geplagt worden zu sein, als sie sich das erste Mal im “Morgenblatt für gebildete Stände“ gedruckt sah.
In einem Brief an Ludwig Tieck schreibt sie:
“(…) Meine paar Novellchen (ziemliche Jämmerlichkeiten, welche durch die Schürzengunst und Critik der Schelling und Cotta (entre nous soit dit) sich den Weg ins Morgenblatt bahnen mußten sind im Morgenbl. gedruckt; sie heißen die Kette und Emilie de Vergy. Letztere überraschte mich gedruckt in Leipzig, aber ich fühlte keine Wonne eines zum ersten mal gedruckten Menschen, sondern tiefe Beschämung über die Erbärmlichkeit des Products, welche mir da erst recht in die Augen fiel. Aber es war ein Machwerk, à commande geschrieben, fast mit vorgeschriebener Seitenzahl, aus dem das Beste noch weggestrichen wurde (…)
In der Tat sind ihre späteren Novellen wie beispielsweise der “Irrwisch-Fritze“ oder die “Russischen Szenen“ sowohl in der Thematik als auch in Stil und Komposition interessanter und besser als die hier erwähnten frühen Novellen.
in diesen bilden weitgehend romantisch-schauerliche Vorkommnisse den Inhalt; so taucht ein Doppelgänger auf, in einer finsteren Schlosskapelle wird um Mitternacht eine heimliche Ehe geschlossen, eine Wahnsinnige irrt durch einen verwilderten Garten Venedigs, es gibt Mord und Totschlag. Aber sicherlich haben diese Motive dem Zeitgeist und wohl auch dem Niveau der “gebildeten Leser“ des Morgenblatts entsprochen. Sie sind jedoch keineswegs kitschig oder trivial dargeboten, wie man vielleicht annehmen möchte. Vor allem in den Erzählungen, die unter dem Titel “Die Gesellschaft auf dem Lande“ zusammengefasst sind, erzählt sie in knappem, fast lakonischem Ton merkwürdige Ereignisse und Gespenstergeschichten, die teilweise rational aufgeklärt, teilweise aber auch nur berichtet werden, ohne dass es zu einer Auflösung kommt. Ähnliche unerklärliche, unheimliche, “parapsychologische“ Geschichten entsprechen ja auch durchaus dem Zeitgeist von 1991…
Vielleicht sollten wir uns kurz über die Zeit klar werden, in der Adelheid Reinbold geschrieben hat und über das literarische Umfeld.
Adelheid Reinbold, 1800 geboren, gehört derselben Generation an wie etwa Annette von Droste-Hülshoff (1797 geboren), Jeremias Gotthelf (1797), Heinrich Heine (1797), Eduard Mörike (1804) und Adalbert Stifter (1805). Neben Werken dieser Autoren erscheinen in den zwei Jahrzehnten, in denen ihre Werke gedruckt werden, aber auch Werke von Eichendorff (1788), Bettina von Arnim (1785), Clemens Brentano (1778) sowie solche von Heinrich Laube (1806), Theodor Mundt (1808) und Georg Büchner (1813). Es sind also Werke, die den Stilrichtungen Romantik, Biedermeier, dem Jungen Deutschland und bereits dem Realismus angehören, wir sehen, wie gleichzeitig die sogenannten Epochen waren.
Wir befinden uns am “Ende der Kunstperiode“; Goethe war bekanntlich 1832 gestorben, aber Ludwig Tieck, der Lehrer Adelheids, der von den Zeitgenossen ebenfalls als einer der großen Vertreter der Kunstperiode angesehen wird, ist quasi als Überbleibsel dieser Epoche weiterhin dichterisch aktiv und wird noch zwei Jahrzehnte lang am Leben sein.
Wie viele Werke der genannten Dichter sind auch die von Adelheid keiner Stilrichtung eindeutig zuzuordnen. Sie ist von ihren Themen her durchaus romantische Dichterin, im Gedankengut nähert sie sich manchmal den fortschrittlich-liberalen Ansichten der Jungdeutschen, und gleichzeitig gehört sie aber auch dem Realismus an, vor allem, wenn man den Begriff “poetischer Realismus“ auf sie anwendet.
Im gleichen Zeitraum sind auch die frühen Werke ihrer Altersgenossin George Sand entstanden, “Indiana“ oder “Leila“, das, 1833 in Paris erschienen, bereits 1834 in deutscher Übersetzung vorlag. Sands 1839 erschienener Roman “Der Uskoke“ wird Adelheid in den “Blättern für literarische Unterhaltung“ sehr negativ rezensieren. Hören wir einige Ausschnitte; anhand ihrer Einschätzung von George Sand erfahren wir gleichzeitig ihr eigenes poetisches Ideal, und dieses ist ein realistisches.
“Wir bemerkten in einer früheren Anzeige, George Sand könne, wenn sie ihre Zerrissenheitsmanier verlasse, wol gar zu der Classe derjenigen Romanenschreiber hinabsinken, deren einziger Zweck die Füllung von Bänden ist, und das vorliegende Werk bestätigt diese Befürchtung schneller, als wir erwartet hatten. Wir würden die Übersetzung schlecht nennen, wären uns nicht noch schlechtere vorgekommen; gern glauben wir daher, daß es sich im Originale anders ausnehmen mag, auch hat es einzelne poetische Schönheiten, wir begegnen hin und wieder einer Bemerkung und malerischen Beschreibungen von Scenerie, wie sie der Sand oft so gut gelingen; doch innere Wahrheit, poetische Nothwendigkeit, Bewälthigung des so interessanten Stoffes finden wir nirgends (…). Überhaupt werden wir uns nie wahrhaft für eine Composition interessiren, in der keine Gestalt in objectiver Kraft hervorspringt und uns zuruft: ich bin! Wo dies in einem Werke der Fall ist, überwältigt es uns immer, nimmt unser Urtheil gefangen und hat ein Recht dazu, denn es ist ein Stück Leben, es macht sich Raum, weil es ist. Wenn auch nur Eine Gestalt dieser Art, nur Ein poetisch Gerechter in einer sonst mangelhaften Erfindung auftritt, können wir sie nicht ganz verwerfen (…). In dem vorliegenden Buche aber lebt Niemand, und wir können keinen Theil an den Abenteuern von Personen nehmen, die ebenso wol anders sein möchten, als wie sie hier nun eben sind (…). Der Autor, selbst nicht hingerissen, reißt im lahmen Gange seiner Erzählung Niemand mit fort, es ist etwas Unsicheres, blos Subjectives darin, an welchem wir die Frau erkennen, die sich zwar in Wissen und Glauben zu emancipiren wußte und die äußersten Grenzen der Negation nicht scheute, die aber die positive Schöpfungskraft des Mannes nicht zu erringen verstand (…).
Weiterhin kommt sie auf Madame de Stael zu sprechen, bei der “das Männermark des Gedankens lebte“, die es verstanden habe, freie selbständige Wesen zu erschaffen. Adelheid Reinbolds dichterisches Ideal ist also offenbar, Gestalten nicht nur als literarische Figuren zu konstruieren, sondern sie mittels Schöpferkraft ins Leben zu bringen, die Figur soll quasi aus dem Text hervorspringen, und das ist ein realistisches, keineswegs mehr romantisches Ideal.
Sie vergleicht die “Bildungen“ – wohlgemerkt nicht “Schöpfungen“ – von George Sand mit “jenen zitternd umrissenen Infusionsthierchen, die im grellen Lichte neuester Beleuchtung in Todeskämpfen durcheinander faseln und zucken“. Dazu ist anzumerken, dass gerade 1838 ein grundlegendes, viel beachtetes Werk über Infusionstierchen oder Aufgusstierchen erschienen war, und es mag zur realistischen Seite von Adelheids Literatur wie auch zu ihrer allseits gerühmten umfassenden Bildung passen, dass sie in ihrer Literaturkritik eine solches aktuelles, naturwissenschaftliches Beispiel wählt.
Aber kommen wir auf die Besprechung George Sands zurück. Nach dieser herben Kritik, es mangele ihr an männlichem Geist, nimmt es sich fast grotesk heraus, dass gerade ihr selbst nach dem Erscheinen ihres Romans “König Sebastian“ der Vorwurf gemacht wird, dass hier “die Frau der Held“ sei, dass die Männer bei ihr meist “wesenlos oder durchweg passiv und weibisch“ sind, “ihren männlichen, interessanten Frauen gegenüber unthatkräftig“. So äußert sich Eduard von Bülow, ein Schriftsteller aus dem Tieck-Kreis, und ihre um dreißig Jahre ältere Schriftstellerkollegin Karoline Pichler findet es unbegreiflich, dass
“ein Weib, das doch eigentlich »weiblich fühlen« und also das männliche Geschlecht in seiner wahren Stellung und in seinem Verhältnis zu uns erkennen sollte, sich darin gefallen kann, das Weib höher als den Mann zu stellen, diesen zur willenlosen Puppe zu erniedrigen, die Leben und Impuls von der Frau empfängt und doch von ihr – unbegreiflicherweise, leidenschaftlich geliebt wird.“
Gegen den letzten Einwand von Karoline Pichler lässt sich allerdings schwerlich etwas einwenden, andrerseits ist ja nun gerade dies eines der großen und allgemeinen Themen der Weltliteratur, bzw. der Liebesromane. [Sand, Indiana; Goethe, Clavigo; Mörike, Maler Nolten].
In der bereits genannten früheren Rezension von Romanen der George Sand äußert Adelheid Reinbold sich anlässlich des Romans “Der Sänger, oder Liebe und Ehe“, im Original “La dernière Aldini“, dem einzigen Roman, den sie rückhaltlos positiv beurteilt, genau in dem oben erwähnten Sinn, nur dass sie ihn ins Positive wendet:
“Dass die Weiber hier die Handelnden sind, der Mann der Leidende ist, bietet einen schönen, ungewöhnlichen Gegensatz.“
Trotz der überwiegend negativen Kritik an George Sand unterscheiden sich die Besprechungen Adelheid Reinbolds durch ihre Sachlichkeit wohltuend von denen des reaktionären “Kritikerpapstes“ Wolfgang Menzel, der, ebenfalls im “Morgenblatt“, George Sand vorwirft, “ihre Phantasie schaffe nur niedrige, lasterhafte, bizarre Charaktere, und schmutzige Situationen…“ usw.; er empfiehlt seinen Lesern und Leserinnen stattdessen die “Entsagungsromane“ deutscher Schrifttellerinnen. Adelheid Reinbolds Werke kann er damit nicht gemeint haben.
Aber kommen wir auf die Kriterien zu sprechen, mit denen man ihr Werk beurteilt hat und die auch diese selbst verwendet hat; vor allem das Epitheton ornans “männlich“ spielt dabei, wie wir schon gesehen haben, eine wichtige Rolle. Wir müssen uns damit abfinden, dass dieses damals ausschließlich positiven Wert hatte. Es taucht bei allen Kritikern auf und ist immer als Lob gemeint.
Bei Ludwig Tieck heißt es:
“Die Verfasserin besaß das große und seltene Talent, ihren Anschauungen die Wahrheit wirklich erlebter Begebenheiten einzuprägen, sodaß die Bilder, die sie uns vorführt, so überzeugend vor unserer Phantasie stehen bleiben, daß sich die poetische Täuschung nur schwer und spät unserm geistigen Auge wieder entzieht. Diese Kraft ist nur dem wahren Talente eigen und wird nur selten gefunden (…). Diese männliche Kraft, diese sichere Zeichnung ist es vorzüglich, was unsere Verfasserin vor so vielen begabten Schriftstellerinnen unsers Vaterlandes auszeichnet.“
In der Sammlung der “Briefe an Ludwig Tieck“ stellt der Herausgeber Karl von Holtei den Briefschreibern und Briefschreiberinnen jeweils eine kurze Charakteristik voran. Bei Adelheid übernimmt er die uns schon bekannte “herrliche Schilderung“ von Rudolf Köpke. Bei dessen Satz
“Sie besaß eine männliche Kraft des Talents“
fügt er die Fußnote hinzu:
“Dennoch war ihr Wesen echt weiblich.“
Der Tieck-Biograph Hermann Freiherr von Friesen, selbst Dichter und Shakespeare-Forscher, schreibt genau in diesem Sinn im Zusammenhang mit ihrem “König Sebastian“:
“Die sachkundige Schilderung von Sitten, Zuständen und Verhältnissen unter den Arabern des nördlichen Africa würde der Feder eines Mannes würdig sein. Dennoch verdient weit höheres Lob die tief gefühlvolle Darstellung ergreifender Situationen, Begebenheiten und Seelenzustände.“
Es wird also immer Wert darauf gelegt, die Verbindung von “männlichem Geist“ und “weiblichem Gefühl“ zu betonen. Besonders schön – und ich meine das jetzt unironisch – formuliert das der schon erwähnte Eduard von Bülow:
“Am schönsten bewährte sich ihr Talent zuverlässig in der Lieblichkeit ihrer Idylle, der ich für sie ein weites Feld in Natur und Gemüth einräume, und die idyllische Haltung der ersten Hälfte des “Sebastian“, der meisterhafte “Irrwisch-Fritze“, “Der kleine Ziegenhirt“ liegen als Beweise vor, nach denen lange Zeit vergehen kann, ehe in dieser Verschmelzung der zartesten, wärmsten Weiblichkeit mit der geistigen Selbständigkeit, Kraft, Kälte und Besonnenheit des Mannes ein so reiches und edles Talent zur Poesie wieder unter uns auftritt.“
Alle diese Urteile wurden geschrieben, als Adelheid nicht mehr lebte. Zu ihren Lebzeiten hat sie unter den Verhältnissen ihrer Epoche gelitten und sich immer wieder zu der nachteiligen Stellung der Frau in der Gesellschaft geäußert, teils indirekt in ihren Werken, teils direkt in theoretischen Abhandlungen, die sie manchmal an den Anfang eines Werks stellte. Als Außenseiterin in der Literaturwissenschaft gestatte ich es mir anzunehmen, dass es der Überzeugung von Adelheid Reinbold selbst entspricht, wenn in der Novelle “Die Nebenbuhlerin ihrer selbst“ die Heldin in schlafloser Stunde sich folgende Gedanken macht:
“Dann dachte sie, daß die Stellung des weiblichen Geschlechts eine unerträgliche sei, daß beim Verschwinden aller Liebe von der Erde, bei der steigenden Schwierigkeit, eine Familie zu unterhalten, Geldrücksichten in Schließung der Ehen immer mehr vorwalten müssten (…) und sie sagte sich endlich, daß, da man die Tendenz der Zeit und den Sittenzustand der Welt nicht gewaltsam ändern könne, das einzige Mittel, ihn zu verbessern, sein würde, den Frauen auch Erwerbsquellen zu sichern (…).Warum, fragte sie, sichert die Erziehung der Frauen ihnen, im Fall das Glück sie verläßt, nicht einen commerziellen oder industriellen Beruf? (…) Handel und Industrie sind breite, alles Andere immer mehr verschlingende Wege, wer verschlösse sie uns? Ist unser Schwur und Wort nicht so viel werth als das der Männer? Wie manche Frauen würden unglückliche Ehen vermeiden, hätten sie das Bewußtsein jener Selbständigkeit (…) Dann würde die Käuflichkeit der Ehe, die sie tiefer untergräbt als alle Doctrinen junger Schwindler, aufhören; die Frauen würden die Retterinnen des heiligen Feuers sein, sie würden durch sich selbst gelten, durch ihre Fähigkeit, ihre Individualität, ihren Werth, nicht durch ihre Atmosphäre, und die Sittlichkeit käme durch sie wieder in die Welt, aus der sie der Mammon täglich mehr verscheucht.“
Mit Atmosphäre ist in diesem Zusammenhang, abweichend von unserem Sprachgebrauch, die Stellung gemeint, die die Frau in der Gesellschaft innehat, im besonderen die verheiratete abhängige Frau.
Dieses Beklagen der mangelnden Sittlichkeit, die durch den Mammon verscheucht wird, mag etwas altklug und restaurativ klingen, aber wir dürfen nicht vergessen, daß die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ja keineswegs “gute alte Zeit“ oder heile Welt war. Im Gegenteil, sowohl sozial als auch politisch war es eine höchst chaotische, in grundlegendem Wandel begriffene Epoche. Die Industrialisierung war bereits fortgeschritten – seit 1837 z.B. gab es schon eine Eisenbahnverbindung zwischen Leipzig und Dresden -, und wir wissen, dass Adelheids Gönner, der Dresdner Einwohner Ludwig Tieck, “das abenteuerlichste Unglück infolge des Daseins der Eisenbahnen absah“ (übermittelt der Neffe Theodor Bernhardi). Im geistigen Leben hatten die Pariser Julirevolution 1830 und der polnische Aufstand nach den Jahren der Restauration eine demokratisch-liberale Aufbruchstimmung mit sich gebracht, die zu vielerlei Unruhen geführt hatte. Auch Hannover und Dresden waren davon betroffen. Mit politischen Zusammenhängen ist Adelheid sicherlich in ihrer Jugend vor allem im Hause Rehberg in Hannover vertraut gemacht worden. Rehberg lebte seit seiner Absetzung in Hannover ab 1820 in Dresden; er hatte Adelheid bei Tieck eingeführt.
Dass sie lebhaften Anteil an den damaligen Dresdner Unruhen genommen hat, wissen wir. Es ist anzunehmen, dass unter dem Einfluss dieser politischen Umstände ihre “Dramatische Novelle Der Prinz von Massa“ entstanden ist, die einen Volksaufstand in Neapel im 17.Jh. zum Thema hat. Die Idee zu dem Roman “König Sebastian, oder wunderbare Rettung und Untergang“ hängt bei ihr wie auch bei anderen zeitgenössischen Schriftstellern sicherlich mit der 1830 begonnenen Eroberung Algiers durch die Franzosen zusammen.
Im geistigen Leben haben jedoch nach dem kurzen politischen Aufschwung bald wieder Unterdrückung und Zensur geherrscht; Adelheid Reinbold schickt also 1831 ein (verschollenes) Drama “Masaniello“, das ein ähnliches Thema wie der “Prinz von Massa“ hat, anonym an den als liberal bekannten Professor und Publizisten Karl von Rotteck im badischen Freiburg mit der Bitte, sich seiner anzunehmen, da sie in Dresden “nicht hoffen könne, die Strenge der Zensur zu überwinden.“ Ebenfalls unter dem Einfluss der geistigen Bewegungen im Gefolge der Julirevolution ist in vielen bürgerlichen Intellektuellen angesichts der verbreiteten Armut allmählich ein soziales Bewusstsein erwacht.
Schwierigkeiten mit dem “Mammon, der die Welt regiert“ hat Adelheid Zeit ihres Lebens am eigenen Leib verspürt, und es wundert nicht, dass Armut und Überlebenskampf in mancher ihrer Novellen ein wichtiges Thema ist (“Die Nebenbuhlerin ihrer selbst“, “Der Irrwisch-Fritze“, “Das Wunder“).
Kommen wir nun aber zu der eben gelesenen Stelle aus der Novelle “Die Nebenbuhlerin ihrer selbst“ zurück. In dem darin zitierten Sinn, dass Frauen nicht zur Selbständigkeit und zu eigener Berufstätigkeit erzogen werden, sondern auf einen Mann angewiesen sind, erschafft sie, wie wir bereits gehört haben, in mehreren ihrer Werke Frauengestalten, die edel und liebesfähig sind, aber aufgrund ihrer naiven Unselbständigkeit sich bedingungslos einem geliebten Mann hingeben, der ihnen charakterlich jedoch weit unterlegen ist und diese Liebe nicht verdient. Sie leiden dann unter Verachtung und Verleumdung und bekommen die Folgen ihrer “regel- und gesetzlosen That“ bitter zu spüren. Unbeirrt bis zum meistens traurigen Ende gehen sie jedoch ihren Weg an der Seite dieses Mannes. Parallel dazu schildert sie dann Ehen, die zwar rechtmäßig geschlossen sind, in denen aber Berechnung und Ehrgeiz mehr zählen als Liebe. Es ist klar, dass die mit Bitterkeit geschilderten Schicksale der edel liebenden Frauen keineswegs im Sinn eines Vorbilds gemeint sind und auch nicht als Beispiele für “Entsagung“, sondern im Gegenteil kritisch und anklagend.
In meinem Beitrag in dem Buch über die bedeutenden Frauen Hannovers habe ich in diesem Zusammenhang bereits auf die Frauengestalten und Figurenkonstellationen in ihrem Roman “König Sebastian“ hingewiesen.
Besonders drastisch kommt dieses Thema auch in ihrem letzten, nicht vollendeten Werk zum Ausdruck, in der Novelle “Der Judenfürst“: Ein angesehener Ratsherr liebt das schöne Judenmädchen Esther. Aus religiösem Eifer, aber vor allem, um sie besitzen zu können, will er sie zum Christentum bekehren. Auf den Einwand Esthers: “Wenn Ihr wollt, daß ich aus Liebe zu Euch zu Eurer Lehre übertrete, so könnte ich von Eurer Liebe zu mir dasselbe fordern“ – weiß der völlig fassungslose junge Mann nur die Antwort zu stammeln: “Wie? Meine Seele verlieren um ein Weib?«
Reinbold hält es also für ihre Aufgabe, auf die wunden Punkte in der Gesellschaft hinzuweisen. Am Anfang ihrer frühen Novelle “Der Hass der Liebe“ fasst sie eine ausführliche philosophische Abhandlung, die sich wieder um die ungerechte Stellung der Frau dreht, bitter zusammen: “Nach diesem Vorwort überlassen wir es dem Leser, ob er unsre Geschichte, eine kleine Episode aus dem großen Bilde der hier bezeichneten Zustände, moralisch oder unmoralisch finden will. Für uns existirt das Wort überhaupt nicht in dieser Beziehung; wir kennen hier nur Wahres und Falsches, und das Wahre ist uns sittlich, das Falsche unsittlich. Wenn der Strafe verdient, welcher, die Pest in einer Stadt zuerst entdeckend, laut aufschreit und den Vorübergehenden zuruft: hier ist der Tod! so bekennen wir, sie in reichem Maaße zu verdienen, so möge uns die Krankheit zuerst hinraffen.“
Adelheid Reinbold ist in diesem Zusammenhang aber auch der Ironie und Selbstironie fähig. Ein kleines Zitat aus der Novelle “Der Doppelgänger“ möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. In einer Gesellschaft hat man gerade beschlossen, Gespenstergeschichten zu erzählen. Ein Offizier, der den Anfang machen soll, beginnt seine Geschichte etwas weitschweifig, indem er über Soldaten- und Preußentum schwadroniert:
“… denn wie Preußen das Haupt Deutschlands ist, das Vaterland des Gedankens, wie ein großer Schriftsteller so schön sagt“ – “Eine Schriftstellerin, wenn es Ihnen beliebt“, sagte eine ältere, etwas pedantisch aussehende Dame. “Sie haben sehr Recht“, erwiderte der Offizier; “Frau von Stael sagt es. Aber ich nenne alle wahrhaft klassische Geister unter den Autoren, ohne Unterschied des Geschlechts, S c h r i f t s t e l l e r, da sie, wären sie es auch nicht, verdienten, Männer zu seyn, und die ungerechte Natur – “ – “Die Natur ist nie ungerecht“, unterbrach ihn die Pedantin etwas spitzig. “Sie haben vollkommen Recht, gnädige Frau, ich begreife auch, daß eine Frau, mit wahrem Genie begabt, von ihrem Standpunkte aus – obgleich dieser immer ein sehr mangelhafter und beschränkter bleiben wird (verstehen Sie mich, nicht vermöge ihres Geistes, sondern ihrer ihr von der Gesellschaft aufgedrungenen Stellung ) – und mit ihrem zarten Herzen, manche Seiten der Lebensansicht auffassen kann, die dem Mann auf s e i n e m Punkt, als einem entgegengesetzten, gerade entgehen muß“ – “Zur Ordnung, zur Ordnung!“ riefen einige Stimmen. Zur Geschichte!“
Das war vor 160 Jahren…
Dass Adelheid mit ihren Ansichten zur Frauenfrage begreiflicherweise nicht allein dastand, möge noch ein Zitat aus dem Nachruf belegen, den ihr die Schriftstellerinnenkollegin Hermine von Chézy (1783-1856) gewidmet hat.
“Sie war schön! – Abhängigkeit und Schönheit, ihr solltet nie Hand in Hand gehen müssen! Schönheit, wie Geist, will Unabhängigkeit von Druck und Drang der Umstände (…)
Zu vorschnell und lieblos wird der Stab über geistige Bestrebungen der Frauen gebrochen und herber Spott über sie losgeschnellt (…)
Ist nicht in den Augen der Meisten geistige Herrschaft der Frauen Usurpation? (Hält nicht noch immer die Meinung das salische Gesetz gegen sie aufrecht?) Freilich ist’s nur der literarische und anderweitige Pöbel, der von Blaustrümpfen spricht und den abgedroschenen Witz von “Stricknadeln“ auftischt, besonders im lieben deutschen Lande.“
Ein letztes Beispiel aus dem Werk Adelheid Reinbolds möchte ich noch bringen. Anhand einer ihrer besten Novellen, den “Russischen Scenen“, soll noch einmal einer ihrer typischen uneigennützigen liebenden Frauengestalten vorgeführt werden; gleichzeitig können wir bei dieser Novelle zusammenfassend auf den literarischen Stil zu sprechen kommen.
Hier wird die wahr und edel liebende Frau, die dem ungetreuen Geliebten jedes Opfer bringt, nicht nur einer herzlosen ungetreuen Ehefrau gegenübergestellt, sondern gleichzeitig mit dem Gegensatz zwischen arm und reich verbunden, bzw. den Abhängigkeitsverhältnissen im alten Russland. Gleichzeitig werden wir durch intensive Schilderungen mit der Landschaft der russischen Steppe vertraut gemacht sowie mit den Sitten, dem Glauben und Aberglauben der ländlichen, aber auch adlig-städtischen Bevölkerung. Es ist als sicher anzunehmen, dass Adelheid diese Gegenden nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Sie hat ihrer Dichtung Reisebeschreibungen und wohl auch mündliche Erzählungen zu Grunde gelegt. Eine Quelle waren nachweislich Benjamin Bergmanns “Nomadische Streifereien unter Kalmücken“.
Darin ist in dem Kapitel “Ssiddi-Kür. Mongolische Erzählungen“ auch die Rede von göttlichen Wesen, die zwar sterblich sind, deren “Lebensjahre sich aber über unendliche Zeiträume ausdehnen“, sie heißen “Tängäri“.
Eine Tängäri ist die wahre Heldin dieser Novelle, eine Kalmückin, die, da sie den wahren Charakter der Menschen durchschaut und selbst unbestechlich ist, als Zauberin und Zigeunerin verschrien und gefürchtet ist; sie wird von ihrem Geliebten, einem reichen Grafen, verlassen. Als dieser nach vielen Jahren verarmt und elend wieder auftaucht, pflegt sie ihn und geht mit ihm in den Tod.
In dieser Novelle gelingen Adelheid Reinbold überzeugende Charaktere, sie wird ihrer eigenen Forderung nach “Schöpfungskraft“ gerecht; nicht nur die edle Kalmückin, auch die verbrecherische Gräfin oder sogar der einfache tumbe Bauer, der enttäuscht vom Leben und von seiner früh gealterten sensibleren kranken Frau dem Geiz verfällt, erstehen überzeugend vor uns. Das entspricht dem realistischen Ideal ihrer Dichtkunst. Gleichfalls aber spielt das Wunderbare, auch wenn es sich teilweise natürlich oder mit dem Aberglauben erklären lässt, entscheidend in die Handlung hinein.
Anhand von zwei Kutschfahrten möchte ich Ihnen diese Mischung aus realistischen und romantischen Elementen zeigen.
“Die Sonne sank im Westen von Rußlands schneeigen Gefilden, und ein Wagen mit vier Pferden bespannt zog schwer über die weite, grenzenlose Flur. Er war auf Schlitten gestellt, schien aber hin und wieder Mühe gehabt zu haben, sich durch Wirbelwinde und Schneefälle Bahn zu brechen, denn das Eis hing hoch oben im Lederwerk, die Pferde waren erschöpft und keuchten mühsam vorwärts, wiewohl das Fuhrwerk sich jetzt auf ebener Bahn befand. Das Gleiten des Wagens über die wellenförmige Fläche, die durchaus keinen zu unterscheidenden Gegenstand darbot, ähnelte der Bewegung eines Schiffes auf ruhiger See, und wie auf der See würde man des Compasses bedurft haben, um hindurch zu steuern, wenn das Fuhrwerk sich nicht schon auf gebahntem Wege befunden hätte. Mattblau lag der Himmel über der Ebene, am Horizont bedeckten ihn kalte Dünste und mischten sich mit der Schneelinie des Bodens, pfeifend glitten die Kufen über die Fläche hin, und ihre Berührung mit dem Schnee und Eis glich klagenden Harmonikatönen, die sich unaufhörlich wiederholten; in diese Musik stimmte das Gebimmel der Glocke, die der Postillon im Gürtel trug, in Russland das einzige Abzeichen seines Dienstes, und die Einförmigkeit in Tönen, Farben und Formen machte einen sonderbar melancholischen Eindruck auf das Gemüth.
Jetzt zeigte sich Gebüsch in der Ferne, und die weißen Stämme verkrüppelter Birken, nebst den dunkelgrünen Häuptern zwergiger Tannen standen hie und da auf kleinen Hügeln am Wege; bald erhoben sich die Stämme mehr und mehr, und der Wagen fuhr durch das Wäldchen von Birken und Erlengebüsch, welches sich rechts und links aus sumpfiger Niederung erhob. Das Reif hatte die Bäume so überdeckt, daß sie aussahen, als wären sie zum zweitenmale und auf andere Weise belaubt, seine einförmige Krystallisation hing sich in die kleinsten Glieder des verschiedenartigen Zweigwerks und bildete dadurch für jede Gattung einen eigenen Baumschlag. Der Weg verengte sich, die Äste reichten dann und wann oben zusammen, und bald fuhr der Wagen durch einen silbernen Laubengang, in dessen Diamanten die sinkende Sonne spielte. Die seltsame Musik, welche den Schlitten begleitete, erhöhte das Magische dieser Scene, das jedoch dann und wann durch die Flüche des Kutschers unterbrochen wurde, dem die Büsche an den bereiften Bart schlugen, oder das Haar zerrauften das gleich beschneitem Gestrüpp an beiden Seiten seiner Mütze hervordrang. Nach und nach wurde der Weg breiter, und man gewahrte Spuren von Wild auf dem Schnee. Da sind Hasen gelaufen! rief der Bediente auf dem Bock, die Nase aus seinem Schafpelz erhebend, sie müssen den Weg in die Kohlgärten genommen haben, wir kommen an ein Dorf!“
In der Kutsche befindet sich eine reiche Gräfin, in Erbschaftsangelegenheiten unterwegs und dabei auch auf dem Weg zu einem Stelldichein mit ihrem Geliebten; sie lässt dafür in dem Dorf eine Bauernhütte von der kranken Bäuerin mit ihrem neugeborenen Kind räumen. Das Kind, das in der kalten Scheune auf den Tod erkrankt, wird von einer Zigeunerin, von Tängäri, geheilt, ebenso wie in der folgenden Nacht das Kind der Gräfin, zu dessen Krankenbett diese von der Ballnacht in der Garnisonsstadt weggerufen wird.
Im nächsten Teil der Novelle sind seither etwa zwanzig Jahre vergangen. Wieder ist die Gräfin in der Steppe unterwegs. Ihr Ziel ist diesmal eine Stadt, in der sie zum Schaden eines Verwandten unrechtmäßig Geld an sich bringen will.
Einer alten Bäuerin am Wegrand verweigert sie Hilfe – es ist die Mutter aus dem Dorf, die ihr Kind, inzwischen als Soldat in der Stadt, noch einmal sehen will, aber die Stadt nicht mehr erreicht; sie stirbt aus Erschöpfung. Aus Angst vor der Rache des Sohnes treibt die Gräfin diesen, der ihren Verführungskünsten knapp widersteht, in den Selbstmord.
Das geschah auf dem Hinweg. Als sich die Kutsche auf dem Rückweg in der Steppe der Stelle nähert, an der sie der Bäuerin die Hilfe verweigert hatte, und als der Kutscher meint, den “Fuchsgeist“, die Zigeunerin, gesehen zu haben, werden in der Gräfin die Erinnerungen an ihr früheres Unrecht wach. Sie glaubt, in einer der Kutsche folgenden Gestalt den Geist der Bäuerin zu erkennen.
“Meine Thiere können nicht weiter, rief der Kutscher, und wir kommen auch, wenigstens in dieser Nacht, nicht weiter; wir sind behext (…)“
Die Gräfin sieht, wie sich in einiger Entfernung “etwas Dunkles erhob. Sie starrte dahin – es war eine menschliche Gestalt. Wie ward ihr aber, als diese Gestalt in hohlen Jammertönen: Hülfe! Rettung! flehte.
Was? rief sie außer sich, stehen die Geister auf? Ich habe das alte Weib ja todt gesehen! Zurück! (…)
Dann taucht plötzlich ein weiteres Gefährt auf:
“Was ist das? fragte sie mit einer Stimme, die sich vergebens mühte, gebieterisch zu scheinen. Sie wagte es hinauszusehen, und entdeckte ein offenes, schlittenförmiges Fuhrwerk, das sie zu verfolgen schien. Es glich einer Droschke, oder einem antiken Wagen ein Mann saß darin, und ein ältliches Weib das die Zügel der Rosse hielt, stand vor ihm.
Das Fuhrwerk jagte wie der Wind über die Trift, die Füße der Rosse schienen den Boden nicht zu berühren. Im ersten Augenblick hielt sie es für eine natürliche Erscheinung, jetzt bemerkte sie aber einen großen, weißen Vogel, der in immer gleichem Fluge über den Häuptern der beiden darinsitzenden Personen schwebte. Ein furchtbarer Zweifel an der Wirklichkeit Dessen, was sie sah, überwältigte sie, und um sich zu jedem Preis davon zu befreien, gebot sie ihren Dienern, ihre Pistolen auf die Gestalten im Wagen abzufeuern. Die Kugel des einen sauste in den Lüften über dem Fuhrwerk weg, die andere traf die Wagenführerin. Entsetzlich, die Kugel prallte von ihrer Brust ab und schlug gegen den Wagen der Gräfin zurück. Jetzt sah sie sich den Schatten der Mutter und des Sohnes preisgegeben, und eine eisige Todesahnung ergriff ihr Herz.“
In dieser Novelle, wie auch in manchen anderen, erweist sich Adelheid Reinbold als Schülerin von Ludwig Tieck, dessen Ziel es ab den zwanziger Jahren war, keine romantischen Novellen mit wunderbaren Inhalten in der Art des Märchens mehr zu schreiben, sondern “realistische“ Novellen, in denen zwar Wunderbares vorkommt, dieses sich aber jeweils als natürlich aufklären lässt. “Ich bilde mir ein, eigentlich unter uns diese Dichtkunst erst aufzubringen, indem ich das Wunderbare immer in die sonst alltäglichen Umstände und Verhältnisse lege“, schreibt er 1822. Er strebt also offensichtlich eine Synthese von Realismus und Romantik an, und in diesem Sinn kann man auch diese Novelle von Adelheid Reinbold sehen.
Der Titel dieses Vortrags hier “Die Romantikerin Adelheid Reinbold“ ist also durchaus gerechtfertigt, wenn wir dabei auch nicht der ganzen schriftstellerischen Breite dieser Dichterin gerecht werden.
Wie sich nun in der eben gehörten Stelle die phantastischen, wunderbaren Elemente natürlich aufklären lassen, verrate ich nicht. Ich empfehle Ihnen stattdessen, die ganze Novelle zu lesen. Sie sollte in der Stadtbibliothek Hannover vorhanden sein.